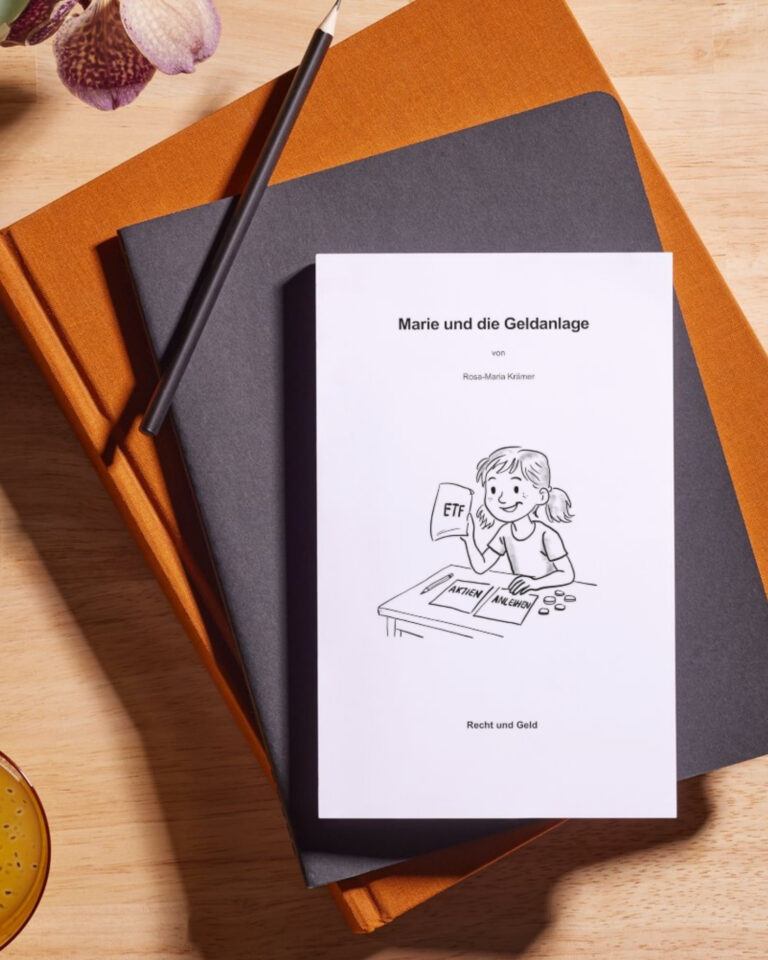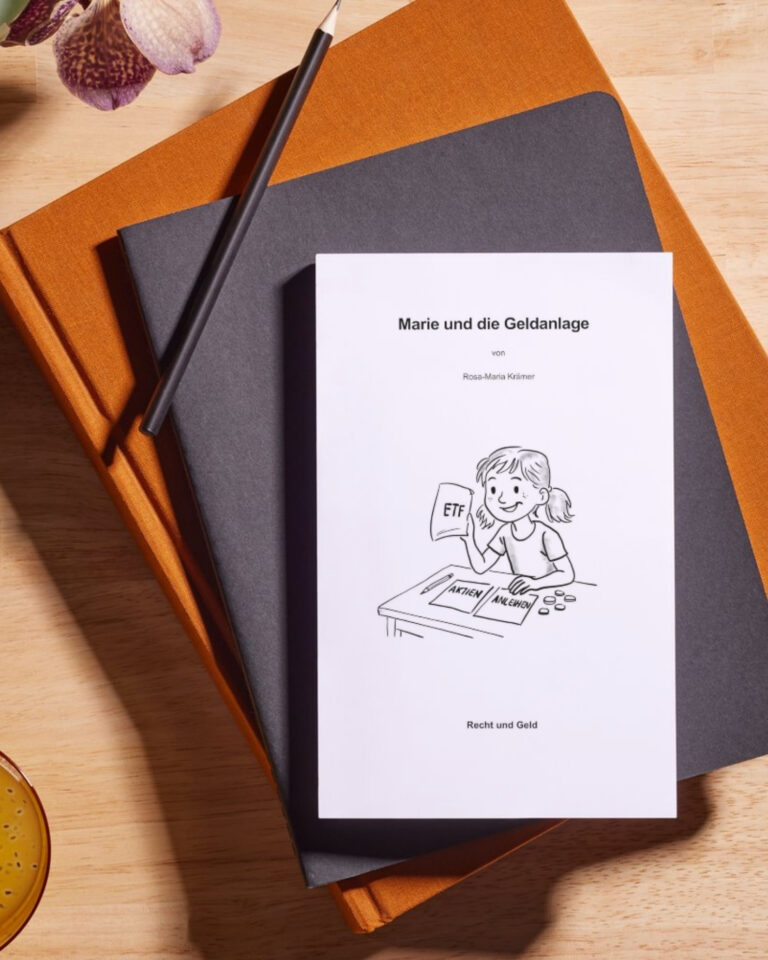Die gesetzliche Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung ist in SGB VI geregelt.
Sie soll für die finanzielle Absicherung im Alter oder bei einer Erwerbsminderung sorgen. Deshalb zahlt sie bei Eintritt des gesetzlich vorgeschriebenen Rentenalters die reguläre Altersrente. Wer aus gesundheitlichen Gründen schon vor dem normalen Renteneintrittsalter nicht mehr arbeiten kann, bekommt eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung. Zusätzlich werden auch noch Maßnahmen bezahlt, die dazu dienen, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern oder wieder herzustellen. Witwer, Witwen und Waisen bekommen nach dem Tod des Versicherten eine Hinterbliebenenrente.
Alle Arbeitnehmer sind in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Nicht versichert sind geringfügig Beschäftigte, Beamte, und Selbstständige.
Die Beiträge zur Rentenversicherung werden gemäß § 168 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt.
Die Beitragsbemessungsgrenze ist bei der Rentenversicherung in § 228a SGB VI geregelt. Sie wird jährlich per Verordnung angepasst und beträgt für das Jahr 2024 nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2024 (SVBezGrV 2024) im Monat 7.550,00 Euro in Westdeutschland und 7.450,00 Euro in Ostdeutschland, also jährlich 90.600,00 Euro in Westdeutschland und 89.400,00 Euro in Ostdeutschland.
Im nächsten Jahr soll die Beitragsbemessungsgrenze für West- und Ostdeutschlang gleich sein. Sie soll monatlich auf 8.050,00 Euro (jährlich 96.600,00 Euro) erhöht werden. Für 2025 gibt es aber noch kein beschlossenes Gesetz. Die Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen. Das Bundeskabinett muss die Verordnung aber noch beschließen und der Bundesrat muss ihr zustimmen, damit die neuen Werte am 1.1.2025 in Kraft treten können.
Bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze beträgt der monatliche Beitrag 18,6% des Brutto-Gehalts des Arbeitnehmers. Die 18,6% ergeben sich aus der Beitragssatzverordnung (BSV) von 2018. Seitdem wurde der Beitragssatz zu Rentenversicherung nicht mehr geändert. Wie bereits oben erwähnt, zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag je zur Hälfte.
Bei dem Brutto-Gehalt eines Arbeitnehmers von 4.400,00 Euro monatlich (52.800,00 Euro jährlich) zahlen er und sein Arbeitgeber zusammen also 818,40 Euro monatlich (9.820,80 Euro jährlich) in die gesetzliche Rentenversicherung ein.
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) sowie Regionalträger. Die Knappschaftsversicherung wird hier nicht behandelt.
Wenn du 5 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt hast, informiert dich die DRV ab dem 27. Geburtstag jedes Jahr über deine Beitragszeiten. In dieser Renteninformation kannst du den aktuellen Stand deiner zukünftigen Rente sehen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, solltest du das gleich mit der DRV abklären. Wenn du mit 67 Jahren in Rente gehst, erinnerst du dich sicher nicht mehr an einen Fehler in der Renteninformation von vor vielen, vielen Jahren.
Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenversicherung ist in SGB III geregelt.
Sie dient der Arbeitsförderung, indem sie Arbeitslose mit dem Arbeitslosengeld finanziell unterstützt und für deren Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sorgt.
Alle Arbeitnehmer sind in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert. Nicht versichert sind geringfügig Beschäftigte, Beamte und Selbstständige.
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern je zur Hälfte getragen. Das ergibt sich aus § 341 Abs. 2 SGB III.
Im Jahr 2024 beträgt der Beitragssatz nach § 341 Abs. 2 SGB III 2,6 % des Brutto-Einkommens des Arbeitnehmers bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze, die auch für die Rentenversicherung gilt (§ 341 Abs. 4 SGB III). Bei der Rentenversicherung wird die Beitragsbemessungsgrenze in § 228a SGB VI geregelt. Sie wird jährlich per Verordnung angepasst und beträgt für das Jahr 2024, wie bereits oben dargestellt, monatlich 7.550,00 Euro in Westdeutschland und 7.450,00 Euro in Ostdeutschland, also jährlich 90.600,00 Euro in Westdeutschland und 89.400,00 Euro in Ostdeutschland.
Wenn die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung im Jahr 2025 erhöht wird, gilt die erhöhte Beitragsbemessungsgrenze demnach auch für die Arbeitslosenversicherung.
Bei dem Brutto-Gehalt eines Arbeitnehmers von 4.400,00 Euro monatlich (52.800,00 Euro jährlich) zahlen er und sein Arbeitgeber zusammen also, 114,40 Euro monatlich (1.372,80 Euro jährlich) in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ein.
Träger der Arbeitslosenversicherung ist die Bundesagentur für Arbeit.
Die gesetzliche Krankenversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung ist in SGB V geregelt.
Sie soll die Kosten für Arzt- und Zahnarztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Zahnersatz, Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, häusliche Pflegeleistungen und Kuren, medizinische Rehabilitationen, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten und Krankengeld bei längerer Krankheit abdecken. Die Kosten sind hoch. Leider werden die Rechnungen der Ärzte und Krankenhäuser den Versicherten nicht übermittelt. Trotzdem schließen die Versicherten häufig noch private Zusatzversicherungen zusätzlich zur gesetzlichen Krankenversicherung ab (z.B. für Zahnersatz, Einbettzimmer, Chefarztbehandlung, etc.). Die privaten Zusatzversicherungen werden hier nicht weiter behandelt.
Alle Arbeitnehmer sind in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Nicht versichert sind geringfügig Beschäftigte, Beamte und Selbstständige.
Versicherte, die mit ihrem Gehalt die Versicherungspflichtgrenze von 69.300,00 Euro überschreiten, dürfen sich auch bei privaten Krankenversicherungen versichern. Das ergibt sich aus § 6 Abs.6 SGB V i.V. m § 2 Abs. 1 SVBezGrV 2024. Sie sind also nicht auf die Träger der gesetzlichen Krankenversicherungen (Kranken- oder Ersatzkassen) beschränkt. Ihnen stehen vielmehr auch alle privaten Krankenversicherungen offen. Sie können sich daher entweder gesetzlich oder privat krankenversichern.
Auch die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind nach § 249 Abs. 1 SGB V zur Hälfte vom Arbeitnehmer und zur Hälfte vom Arbeitgeber zu tragen. Zu beachten ist aber, dass der Arbeitgeber nur die Höhe der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (nicht höhere Kosten von Privatversicherungen) hälftig tragen muss, und auch die Arbeitnehmer ihre Hälfte nur in Höhe der gesetzlichen Krankenversicherung bei der Einkommenssteuererklärung im Rahmen der Sonderausgaben absetzen können.
Im Jahr 2024 betrug der Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung 14,6 %. Das ergibt sich aus § 241 SGB V.
Sowohl bei pflichtversicherten als auch bei den freiwillig versicherten Mitgliedern werden die Einkünfte insgesamt höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 5.175 Euro im Monat bzw. 62.100 Euro im Jahr für den Beitragssatz berücksichtigt. Das folgt aus § 2 Abs. 2 SVBezGrV 2024.
Auch die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung soll im nächsten Jahre erhöht werden. Vorgeschlagen wurde eine Grenze von 5.512,50 Euro im Monat, also 66.150,00 Euro im Jahr. Für die Jahresarbeitsentgeltgrenze waren nach den Entwürfen ein Brutto-Gehalt von 6.150,00 Euro monatlich, also 73.800, Euro jährlich, im Gespräch.
Bei dem Brutto-Gehalt eines Arbeitnehmers von 4.400,00 Euro monatlich (52.800,00 Euro jährlich) zahlen er und sein Arbeitgeber im Jahr 2024 also 642,40 Euro monatlich (7.708,80 Euro jährlich) in die gesetzliche Krankenversicherung ein.
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Ortskranken-, Betriebskranken- und die Ersatzkassen. Die Innungskassen entfallen, da hier die knappschaftlichen Regelungen nicht besprochen werden.
Zusätzlich zum oben genannten Beitragssatz von 14,6% verlangen die Krankenkassen bereits heute Nach § 242 SGB V Zusatzbeiträge. Die Höhe kann jede Krankenkasse selbst bestimmen. Im Durchschnitt betragen diese individuellen Zuschläge derzeit 1,7%. Die Krankenkassen diskutieren aber für das nächste Jahr, diese individuellen Zusatzbeiträge auf durchschnittlich 2,5% zu erhöhen.
Rechnet man die in 2024 die normalen Beiträge und die Zusatzbeiträge zusammen, werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer insgesamt 717,20 Euro monatlich, also 8.606,40 Euro jährlich, in die gesetzliche Krankenversicherung gezahlt.
Ein Arbeitnehmer, dessen Brutto-Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze 5.775,00 Euro monatlich (69.300,00 Euro jährlich) liegt, darf sich auch privat versichern. Tut er das, und sein Gehalt liegt über der Beitragsbemessungsgrenze von 5.175,00 Euro monatlich (z. B. bei 6.000,00 Euro), sieht die Berechnung so aus: Angenommen er hat eine private Krankenversicherung über 800,00 Euro abgeschlossen. Dann würde der Beitrag des Arbeitgebers die Hälfte des Beitrags bis zur Beitragsbemessungsgrenze (5.175,00 Euro), also 377,77 Euro (5.175,00 x 14,6% geteilt durch 2) nicht überschreiten, auch wenn die private Krankenversicherung insgesamt 800 Euro monatlich kostet. Der Arbeitnehmer müsste dann 422,23 (800,00 minus 377,77 Euro) als Beitrag zahlen.
Die gesetzliche Pflegeversicherung
Die gesetzliche Pflegeversicherung ist in SGB XI geregelt. Sie soll die Kosten abdecken, wenn jemand pflegebedürftig wird. Je nach Pflegegrad werden die Kosten bis zu bestimmten Höchstbeträgen übernommen.
Pflichtversichert sind auch hier alle Arbeitnehmer. Nicht versichert sind geringfügig Beschäftigte, Beamte und Selbstständige. Nach § 48 SGB XI ist aber jede Krankenkasse und auch jede private Krankenversicherung verpflichtet, ihren Versicherten eine Pflegeversicherung anzubieten. Privat Krankenversicherte sind nach 23 SGB XI verpflichtet, bei ihrer privaten Krankenversicherung auch eine Pflegeversicherung abzuschließen.
Nach § 55 Abs. 1 SGB XI beträgt der Beitragssatz für die gesetzliche Pflegeversicherung 3,4%. Auch dieser Beitrag ist vom Arbeitnehmer mit einem Kind und vom Arbeitgeber ohne Berücksichtigung der Zu- und Abschläge bei Kinderlosen und Arbeitnehmern mit mehr als einem Kind hälftig zu tragen. Hier gibt es also die Besonderheit, dass der Arbeitgeber stets 1,7% trägt und der kinderlose Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer mit mehreren Kindern den Rest. Arbeitnehmer ohne Kinder müssen im Jahr 2024 gemäß § 55 Abs. 3 SGB XI einen Zuschlag von 0,6% zahlen. Sie haben daher einen Beitragssatz von 4% ihres Brutto-Gehalts, wovon der Arbeitgeber 1,7% zu tragen hat. Versicherte mit einem Kind – unabhängig davon, ob das Kind über oder unter 25 Jahre alt ist – müssen Beiträge in Höhe von 3,4% des Brutto-Gehalts zahlen. Auch hiervon trägt der Arbeitgeber 1,7%, d.h., der Beitrag wird hälftig geteilt. Für jedes weitere Kind gibt es nach § 55 Abs. 3 SGB XI einen Abschlag in Höhe von 0,25% vom Beitragssatz, allerdings nur für Kinder unter 25 Jahren. Bei zwei Kindern beträgt der Beitragssatz 3,15%, bei drei Kindern 2,9%, bei 4 Kindern 2,25%, bei fünf Kindern und mehr 2,4%. Auch hiervon trägt der Arbeitgeber immer 1,7%.
Bei dem Brutto-Gehalt eines Arbeitnehmers von 4.400,00 Euro monatlich (52.800,00 Euro jährlich) zahlen er und sein Arbeitgeber zusammen also 149,60 Euro monatlich (1.795,20 Euro jährlich) in die gesetzliche Pflegeversicherung ein. Ein alleinstehender Arbeitnehmer muss 0,6% mehr zahlen, also nicht nur 74,80 Euro monatlich (149,60 Euro geteilt durch 2), sondern 101,20 Euro monatlich (1.214,40 Euro jährlich), also 26,40 Euro monatlich (316,80 Euro jährlich) mehr.
Die Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung sind die Ortskranken-, Betriebskranken- und die Ersatzkassen. Die Innungskassen entfallen, da hier die knappschaftlichen Regelungen nicht besprochen werden. Bei einem privatversicherten Arbeitnehmer, der über der Versicherungspflichtgrenze liegt, die von ihm gewählte private Krankenversicherung.
Auch bei der gesetzlichen Pflegversicherung ist eine Erhöhung des Beitrags für 2025 im Gespräch.
Die gesetzliche Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung ist in SGB VII geregelt. Die Versicherung soll die Kosten von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten abdecken und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhüten.
Pflichtversichert sind auch hier alle Arbeitnehmer und Auszubildende aber auch Schüler und Studierende sowie Arbeitslose. Darüber hinaus können noch weitere Personengruppen versichert sein (vgl. §§ 2, 3 SGB VII). Nicht versichert sind Beamte. Auch die Personengruppe derer, die sich freiwillig versichern kann, ist größer als bei den anderen gesetzlichen Sozialversicherungen.
Arbeitnehmer oder anderen Pflichtversicherte müssen zur Unfallversicherung keinerlei Beiträge bezahlen. Hier entrichtet allein der Arbeitgeber den gesamten Beitrag allein. Dem Arbeitnehmer wird hierfür also nichts von seinem Brutto-Gehalt abgezogen.
Die Finanzierung richtet sich nach den Löhnen der Arbeitnehmer und nach Gefahrenklassen.
Auf der nachstehenden Webseite des Arbeitgeberverbands beträgt der durchschnittliche Beitragssatz des Arbeitgebers 1,124 % des Brutto-Lohns seines Arbeitnehmers (vgl. nachstehenden Link):
https://arbeitgeber.de/themen/sozialpolitik-und-soziale-sicherung/unfallversicherung/
Bei dem Brutto-Gehalt eines Arbeitnehmers von 4.400,00 Euro monatlich (52.800,00 Euro jährlich) zählt der Arbeitgeber allein daher 49 Euro monatlich (588,00 Euro jährlich) in die gesetzliche Unfallversicherung ein.
Schlussbemerkung
Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung (1. Säule der Alterssicherung) sind nicht besonders hoch. Sie betrugen nach dem folgenden Link bei Männern in Westdeutschland durchschnittlich 1.382,00 Euro und bei Frauen 797,00 Euro. In Ostdeutschland erreichten Männer im Schnitt 1.356,00 Euro und Frauen 1.135,00 Euro.
Rente: Wer bekommt 2300 Euro Rente im Monat?
Selbst wer 45 Jahre lang voll in die Rentenversicherung einzahlt, erhält nach dem folgenden Link
Medienbericht: Deutsche Durchschnittsrente bei 1543 Euro | tagesschau.de
Im Durchschnitt nur 1.543,00 Euro monatlich als Altersrente ausbezahlt.
Davon gehen noch Steuern ab. Außerdem bekommen nur die wenigsten Arbeitnehmer 45 Versicherungsjahre zusammen.
Wenn man nur 40 Versicherungsjahre in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, müsste man nach dem nachstehenden Link mindestens 6.000,00 Euro brutto monatlich in allen 40 Jahren verdienen (also 72.000 Euro jährlich).
Wie viel du für 2.000 € Rente verdienen musst. | VisualVest
Schlecht ist dabei, dass nach eben diesem Link gut 89% der Arbeitnehmer weniger verdienen.
All diese Ausführungen sind schwer verständlich, wenn man sieht, wie viel Beitragsgeld von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen eingezahlt werden. Das wurde eingangs berechnet und in der Tabelle dargestellt. Vielleicht sollten alle, die niemals Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, auch keine Rentenpunkte bekommen. Politische Wohltaten sollten aus Steuergeldern bezahlt werden.
Mache Arbeitnehmer haben neben der gesetzlichen Rente noch eine Betriebsrente (2. Säule der Alterssicherung), aber nicht alle.
Daher wird immer darauf hingewiesen, dass man fürs Alter auch allein vorsorgen muss (3. Säule der Alterssicherung). Das geschieht über eine private Zusatzversicherung oder durch Ersparnisse, die so früh wie möglich bei Banken und Sparkassen in Wertpapiere angelegt werden. Auch eine eigene, bereits abbezahlte Immobilie hilft oder die Mieteinnahmen bei einer vermieteten Immobilie.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung werden ebenfalls oft Zusatzversicherung abgeschlossen. Manche mögen eine Chefarztbehandlung oder ein Einzelzimmer, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Auch beim Zahnersatz wird teilweise eine private Zusatzversicherung benötigt. Bei der Pflegeversicherung gibt es ebenfalls private Zusatzversicherungen. Die gesetzliche Pflegeversicherung wird daher auch Pflegepflicht- und die private Zusatzversicherung Pflegezusatzversicherung genannt.
Die geplanten Erhöhungen der Beiträge im Jahr 2025 wurde von den Krankenkassen auch damit gerechtfertigt, dass die Bundesregierung zu wenig für Bürgergeld- und Sozialhilfeempfänger an sie überweise, die ja ebenfalls Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten. Nach dem folgenden Link überweist der Bund den Krankenkassen nur 119,00 Euro monatlich pro Bürgergeldempfänger, im Durchschnitt seien aber 350,00 Euro monatlich notwendig.
So viel Krankenversicherungsbeitrag zahlen Sie für Bürgergeld-Empfänger mit – FOCUS online
Die Differenz zwischen 350,00 und 119,00 Euro, also 231,00 Euro monatlich (also 2.772,00 Euro jährlich) pro Bürgergeldempfänger müssten im Moment die Beitragszahler leisten. Daher gilt auch bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, dass nur der Leistungen erhalten sollte, der Beiträge eingezahlt hat. Soziale Wohltaten sollten immer aus Steuergeldern bezahlt werden.
Vielleicht könnten auch die Beitragsbemessungsgrenzen gesetzlich einheitlich festgesetzt werden. Das würde die Berechnung der Beiträge vereinfachen. Dann könnte auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze wieder abgeschafft werden. Die vielen Vorschriften des SGB zu den einzelnen Sozialversicherungen sind verwirrend.
Außerdem täuschen auch die Zahlen bei der gesetzlichen Sozialversicherung. Sie sehen niedrig aus, weil die Beiträge in Prozentsätzen angegeben werden. Im Grunde sollten immer auch die Jahreswerte betrachtet werden, und zwar zusammen mit den Arbeitgeberbeiträgen. Nur so sieht man, um welch hohe Summen es da tatsächlich geht. Außerdem werden auch die Arbeitgeber bei der Berechnung des Brutto-Gehalts ihrer Arbeitnehmer stets die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung im Hinterkopf haben.
Ich hoffe, dass dieser Blog dein Interesse an der gesetzlichen Sozialversicherung geweckt hat. Denn der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung zahlt hier Beiträge ein.